Wer mich kennt, weiß: Ich liebe es, meine fehlende Finanzbildung oder persönliche Werteentwicklung aus Büchern zu ziehen. Zwei Werke haben mich zuletzt besonders geprägt – und das nicht nur wegen ihres Inhalts, sondern auch wegen der politischen Entwicklungen auf beiden Seiten des Globus. Keine Sorge, das wird keine Polit-Kolumne. Ich bleibe bei meinem Herzensthema: Finanzbildung, die auf Gleichberechtigung und Chancengleichheit einzahlt.
Und doch lässt sich eins nicht ignorieren: Die Art und Weise, wie sich unser Verhältnis zu Reichtum verändert hat – und was das mit unserer Gesellschaft macht. Sebastian Klein trifft in seinem Buch „Toxisch reich“ den Nerv der Zeit. Er beschreibt, was passiert, wenn großer Reichtum nicht mehr nur Statussymbol ist, sondern zur Gefahr für unsere Demokratie wird.
Vom Millionär zum Milliardär – die stille Verschiebung unserer Bewunderung
Werfen wir einen kurzen Blick zurück: In den 90ern, als ich aufgewachsen bin, waren Millionäre die Helden der Boulevardpresse. Die Reichen und Schönen, mit Yachten, Villen und Glanz. Heute scheint das nicht mehr genug. Wir blicken mit bewunderndem Staunen auf Milliardäre – Menschen, die nicht nur ihr Vermögen exponentiell gesteigert, sondern ihren Einfluss bis in höchste politische Sphären ausgedehnt haben.
Doch was bewundern wir da eigentlich? Und warum?
Die Zahlen sprechen für sich: Das reichste 1 % der Bevölkerung in Deutschland besitzt rund ein Drittel des gesamten Vermögens. In der Politik sind Menschen aus der oberen Vermögensschicht überrepr.sentiert. Wer wenig oder durchschnittlich verdient, findet dort kaum eine Stimme.
Und dann ist da noch das Märchen vom Selfmade-Milliardär. Geschichten von Elon Musk, Bill Gates oder Jeff Bezos, die sich scheinbar aus dem Nichts ein Milliardenimperium aufgebaut haben. Was oft ausgeklammert wird: der Reichtum, aus dem sie kamen. Bill Gates bekam in den 70ern einen Computer geschenkt, der damals mehr kostete als ein Kleinwagen. Elon Musk stammt aus einer wohlhabenden Familie und konnte sich frühzeitig Investitionen leisten. Es geht also nicht nur um kluge Ideen sondern um Zugang, Startkapital und ein Sicherheitsnetz, das viele Menschen niemals haben werden.
Das macht etwas mit uns
Wir vergleichen uns, oft unbewusst. Fragen uns, warum wir keine revolutionären Unternehmen gründen, kein Unicorn starten, kein Vermögen aufbauen. Dabei übersehen wir, dass der Aufstieg zum Reichtum meist mit vererbten Privilegien beginnt. Und das ist gefährlich. Denn es normalisiert eine Ungleichheit, die nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich toxisch ist.
Diese Erkenntnis teilen auch Menschen wie Marlene Engelhorn. In ihrem Buch „Geld“ beschreibt sie ihre Auseinandersetzung mit dem Erbe ihrer reichen Familie und wie sie ihre Verantwortung darin sieht. Mit der Initiative taxmenow setzt sie sich für die Wiedereinführung der Vermögenssteuer ein und fordert mehr Gerechtigkeit bei der Verteilung von Wohlstand. Sie ist kein klassisches Role Model und gerade deshalb so wichtig: Weil sie sich nicht nur selbst reflektiert, sondern auch aktiv handelt.
Wer zerstört unseren Planeten?
Lassen wir Zahlen sprechen: Studien belegen, dass das reichste Prozent der Weltbevölkerung für den größten Teil der klimaschädlichen Emissionen verantwortlich ist. Privathaushalte sollen sparen, recyceln und weniger fliegen während Superreiche mit ihren Privatjets von Meeting zu Meeting jetten. Ja, wir alle können und sollten Verantwortung übernehmen. Aber es ist illusorisch zu glauben, dass Klimagerechtigkeit ohne eine radikale Umverteilung gelingen kann.
Müssen wir reich sein, um frei zu sein?
In all dem stellt sich eine zentrale Frage: Muss man Millionär:in sein, um sich sicher, frei und unabhängig zu fühlen? Oder geht das auch anders?
Hier kommen Lebenskonzepte wie Frugalismus oder Minimalismus ins Spiel. Wer frugal lebt, konsumiert bewusst, spart gezielt und stellt sich die Frage: Was brauche ich wirklich? Minimalismus wiederum richtet den Blick auf das Wesentliche – und weniger auf Statussymbole. Diese Lebensstile können befreiend sein. Nicht, weil sie Reichtum versprechen, sondern weil sie Unabhängigkeit im Hier und Jetzt ermöglichen.
Finanzielle Freiheit bedeutet eben nicht, reich zu sein. Sondern sich ein Leben aufzubauen, das nicht von Konsumdruck oder Existenzangst getrieben ist.
Ein neuer Blick auf Reichtum
Was wir brauchen, ist ein neues Verständnis von Wohlstand. Eines, das nicht auf Macht, Einfluss oder Superyachten basiert. Sondern auf Gerechtigkeit, Teilhabe und Nachhaltigkeit. Reichtum darf kein Ziel um seiner selbst willen sein. Und schon gar kein Maßstab für Erfolg oder Wert.
Wenn Menschen wie Sebastian Klein oder Marlene Engelhorn ihre Privilegien hinterfragen und Verantwortung übernehmen, dann zeigen sie: Es geht auch anders. Es braucht mehr solcher Vorbilder – und weniger Gier.
Denn toxischer Reichtum ist nicht nur ein ökonomisches Problem. Er ist eine Bedrohung für unsere Demokratie, unsere Umwelt und unser gesellschaftliches Miteinander.
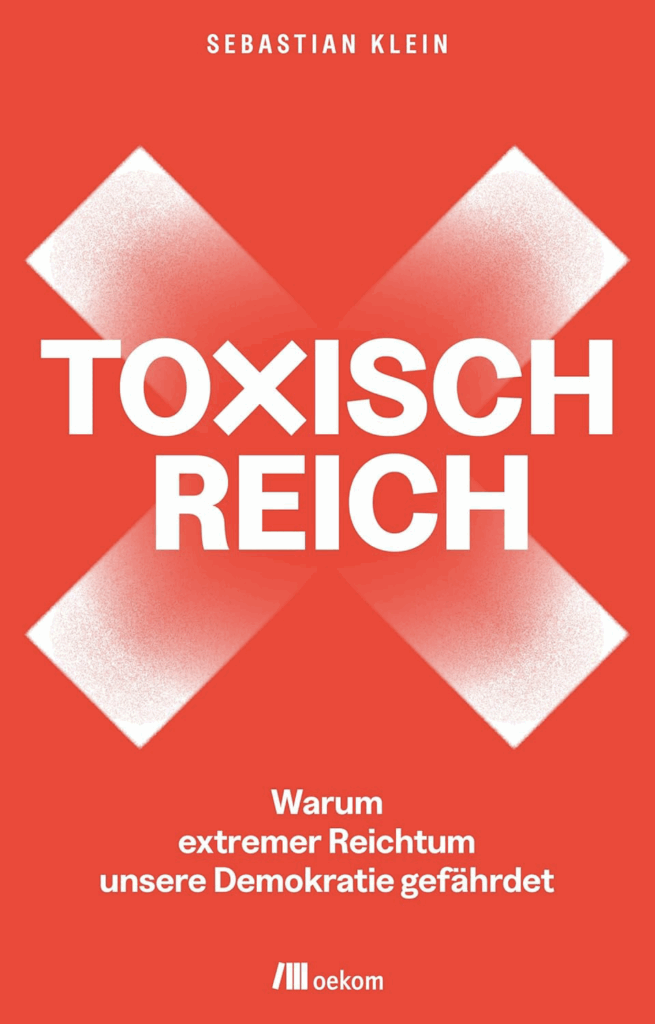
Toxisch Reich: Warum extremer Reichtum unsere Demokratie gefährdet
von Sebastian Klein
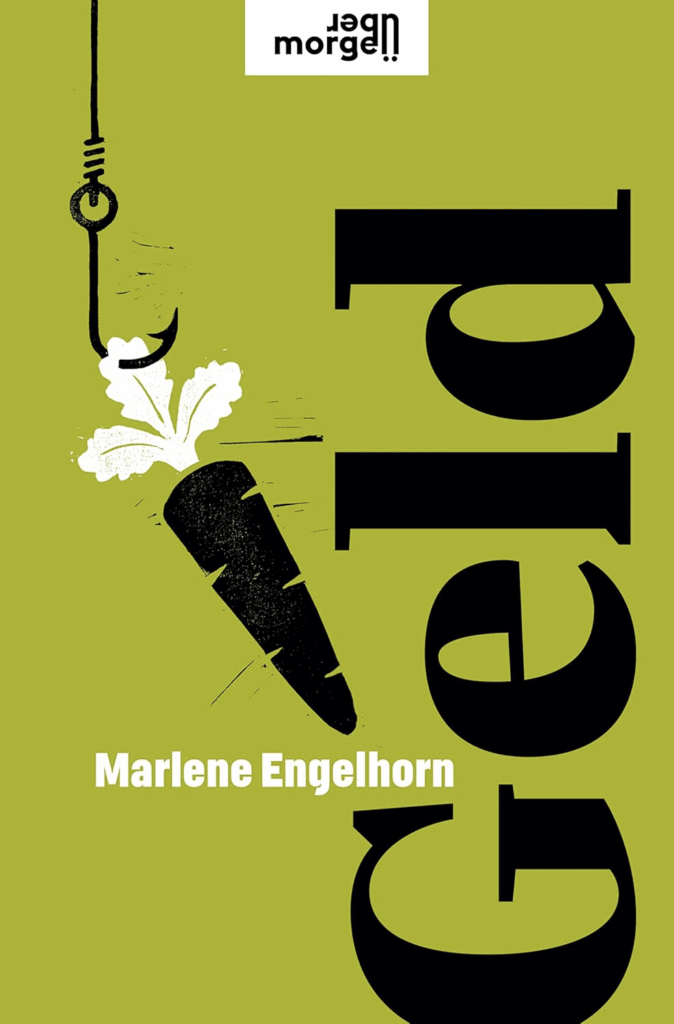
Geld
von Marlene Engelhorn










